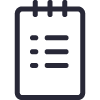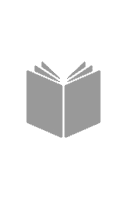Was man im Jurastudium lernt – und was nicht (und überhaupt: was das Studium mit uns macht)
von Prof. Dr. Roland Schimmel
Wie man erfolgreich Jura studiert, erfährt man in hunderten von YouTube-Videokurzanleitungen und in ein paar ziemlich guten Ratgeberbüchern. Ob man überhaupt Jura studieren will, ist eine andere Frage. Die man aber als erste beantworten sollte.
Was lernt man im Jurastudium?
Im Studium lernt man – gefühlt – große Mengen materielles Recht. Das sind die Regeln, die inhaltlich darüber entscheiden, was „richtig“ ist, wer sich also bei Interessenkonflikten durchsetzt. Das Verfahrensrecht tritt demgegenüber ein wenig in die zweite Reihe, aber das ändert sich im Referendariat. Das materielle Recht wird noch heute in drei großen Säulen unterrichtet, die auch die Prüfungen bestimmen:
- Strafrecht,
- Öffentliches Recht,
- Zivilrecht.
An letzteres schließen sich Gebiete wie Arbeitsrecht und Unternehmens- und Gesellschaftsrecht an. Die inhaltlichen Übergänge sind zahlreicher als es die Schärfe der begrifflichen Unterscheidung vermuten lässt. Und wie „gefühlt“ schon andeutet, ist das alles nur ein Ausschnitt aus dem tatsächlich geltenden Normenbestand. Täglich kommt etwas dazu – und ständig erfinden Juristenkollegen neue Rechtsgebiete, auf denen sie sich als Spezialisten etablieren können (letzthin stolperte ich über ein ganzes Buch zum „Fuhrparkrecht“; von solchen Spezialmaterien ist an der Uni nicht die Rede).
Dieses Wissen zum Bestand an geltenden Rechtsregeln ist wertvoll, aber von Veraltung ständig bedroht. Viele Grundzüge der gesetzlichen Regeln bleiben über Jahrzehnte und Jahrhunderte stabil und halten länger als ein Berufsleben. Viele Detailregelungen werden geändert, manche in kurzem Takt. Was also den Inhalt des geltenden Rechts angeht, hat man am Ende des Studiums ganz sicher nicht ausgelernt. Die meisten juristischen Kollegen lernen laufend Neues, kraft eigener thematischer Spezialisierung einerseits, kraft neuer Regelungen andererseits. Wer vor Beginn des Studiums noch gedacht haben sollte, er werde eines Tages souverän Rechtsauskünfte aus dem Kopf geben können, sieht sich getäuscht und enttäuscht: Auf die allermeisten Fragen muss man auch nach einem ehrgeizig und neugierig betriebenen Studium antworten: Das muss ich recherchieren. So gesehen lernt man auch eine Portion Demut im Studium.
Vermutlich wichtiger als Kenntnisse im heute geltenden Recht ist, was man als Text- und Systemverständnis bezeichnen könnte. Das juristische Studium schärft vom ersten Tag an den Blick für Texte. Wichtig ist eine regelgeleitete Interpretation von Texten – Juristen sprechen üblicherweise von Auslegung –, die fast zwangsläufig Unvollständigkeiten („Lücken“) und Unklarheiten aufweisen.
Damit methodisch regelgeleitet, also auch rechtsstaatlich vorhersagbar und kontrollierbar, umzugehen, ist eine kleine Kunst. Die erlernt man im Studium, teils explizit in Kursen über Methodenlehre, zu einem guten Teil eher beiläufig. Manches lernt man auch erst aus Fehlern, die man in den Prüfungen unter die Nase gerieben bekommt.
(Übrigens, Stichwort Prüfungen: Bescheidenheit lernt man auch.)
Wie man Texte unterschiedlicher Autorität – Gesetze, Gerichtsentscheidungen, wissenschaftliche und didaktische Texte – findet und nutzt, wie man sie liest und was man von ihnen erwarten kann, dafür entwickelt man ein Verständnis. Welche Regel Ausnahmen hat und wo im Gesetz sie zu finden sind, welche Vorschrift von Rechtsprechungsrecht geradezu „überwuchert“ ist und überhaupt wie sich verschiedene konkurrierende Regeln zueinander verhalten, muss man überblicken oder sich wenigstens in halbwegs übersichtlicher Zeit erschließen können.
Fast genauso wichtig wie Texte zu lesen und zu verstehen ist es, spezifisch juristische Texte schreiben zu können. Im Studium steht im Mittelpunkt das Rechtsgutachten. In den damit eng verbundenen Gutachtenstil finden sich viele Studenten eher mühsam hinein. In der zweiten Reihe stehen Themenarbeiten, die wiederum Referaten aus Schulzeiten ähneln, aber hinsichtlich der Quellenauswertung und des damit verbundenen sogenannten wissenschaftlichen Apparats deutlich anspruchsvoller sind.
Das alles klingt harmlos, aber es beansprucht etwa fünf Jahre Zeit.
Wer etwa das Studium aufnimmt in der Erwartung, am Ende eine glanzvolle und maximal-überzeugende Rede nach der Art eines Plädoyers vor Gericht halten zu können, wird sich massiv getäuscht haben. Mündliche Prüfungen finden im Studium kaum statt – und Rhetorik spielt nur eine kleine Rolle, eher als die Lehre von guter Strukturierung von Sachargumenten als als „schwarze“ Rhetorik mit fiesen Tricks, die den Gegner und seinen Standpunkt in schlechtem Licht dastehen lassen.
Wer solche Themen wichtig findet, muss sich einen Debattierclub suchen.
Man lernt auch – merkwürdig genug – nicht, in Gruppen zu arbeiten. Obwohl in fast allen beruflichen Zusammenhängen Teamfähigkeit seit Jahrzehnten großgeschrieben wird, finden juristische Prüfungsleistungen ungebrochen fast nur als Einzelleistungen statt.
Nur viel zu wenig lernen Jurastudenten Rechtssetzung, sei es als Gesetzgebung, sei es als Vertragsgestaltung. In letzterer Hinsicht gibt es vorsichtige Tendenzen zur Besserung. Insgesamt aber wird man zum Rechtsanwender ausgebildet – und das greift oft zu kurz.
Was man ebenfalls fast nicht lernt, ist, wie eigentlich die Tatsachen ermittelt werden, aus denen sich ein juristischer „Fall“ (unter Kollegen: ein Sachverhalt) zusammensetzt. Praktisch während des gesamten Studiums liegt der Sachverhalt – ausgedacht oder einem echten Geschehen nachgebildet – als ein Blatt Papier in der Vorlesung oder der Prüfung auf dem Tisch und darf als vollständig wahr und beweisbar angesehen werden. Die fiesen Beweisfragen, an denen sich viele Rechtsstreitigkeiten vor Gericht oder vorgerichtlich entscheiden, bleiben weitgehend ausgeblendet. Auch das ändert sich allerdings im Referendariat.
In Sachen „Blick über den Tellerrand“ sieht es ebenfalls nicht so gut aus: Zwar kann jeder nach Belieben in Veranstaltungen an Nachbarfachbereichen hineinhören – Wirtschaftswissenschaften, Geschichte, Politikwissenschaften, Psychologie, Philosophie, Sprachen, Informatik, was immer Ihnen einfällt. Aber zwingend ist nichts davon. Als Jurist ist man in erster Linie Jurist. Leider gilt das auch für die Grundlagenfächer (Rechtsgeschichte, Rechtstheorie, Rechtssoziologie), die oft stiefmütterlich behandelt werden, nicht zuletzt, weil sie in der Prüfung nur eine kleine Rolle spielen.
Überhaupt tut man gut daran, die Erwartungen an die Praxistauglichkeit des Studiums nicht zu überspannen. Selbst nach dem Referendariat und einem bestandenen zweiten Staatsexamen ist der Volljurist zwar fast überall zu gebrauchen, aber beinahe nirgends sofort voll einsetzbar. Wie man als Richter ein Dezernat führt oder sich als Rechtsanwältin erfolgreich selbständig macht, bekommt man nämlich nicht beigebracht.
Der vielleicht eigenartigste Eintrag auf der Liste der Dinge, die man nicht lernt, lautet „Gerechtigkeit“. Obwohl bestimmt die Hälfte der Studienanfänger als Grund für ihre Wahl „Interesse an Gerechtigkeit“ angeben würde (die andere Hälfte würde darauf reimen „Verlegenheit“), kommt das Thema im Studium höchstens in der Rechtsphilosophie-Vorlesung vor, die kaum einer belegt, weil sie als „nicht examensrelevant“ gilt. Im Übrigen erweist sich „Gerechtigkeit“ meist beim Bearbeiten von lerntauglichen Konfliktsachverhalten („Fällen“) als viel zu große Münze: Man bekommt die Probleme mit Rechtsfiguren wie „rechtmäßiges Alternativverhalten“ oder „allgemeines Lebensrisiko“ oder „überholende Kausalität“ viel besser in den Griff. Und je weiter das Studium fortschreitet, desto weniger vermisst man die Gerechtigkeit als das eigentlich alles entscheidende Argument.
... und was das Studium mit Dir anstellen könnte
Damit deutet sich schon an: Das Jurastudium macht andere Menschen aus denen, die es neugierig-ahnungslos betreten. Klar: Aus einem Studium von durchschnittlich fünf Jahren Dauer (die Prüfungsphase und das typischerweise sich anschließende Referendariat noch nicht eingerechnet) geht man sowieso nicht als derselbe Mensch heraus, als der man hineingegangen ist. Was macht aber spezifisch das Jurastudium mit dem Menschen? Jeder nimmt einen anderen Weg, aber ein paar Verallgemeinerungen sind vielleicht erlaubt.
Bei vielen Kollegen löst das Studium die eine oder andere feste Überzeugung auf. Man lernt, bei nicht eindeutig zu entscheidenden Fragen stärker in „einerseits/andererseits/kompromisserseits“ zu denken als in „das eindeutig und begründungslos richtige Ergebnis lautet: …“. Manche Gewissheit über „gerecht“ und „ungerecht“ gerät ins Wanken – aber ein paar andere bilden sich vielleicht auch neu.
Die meisten Menschen verlassen das Studium mit systematischerer Arbeitsweise. Das liegt gewiss an den vielen gedanklichen Schemata, mit denen man ab der ersten Woche konfrontiert ist. Manche werden geradezu zu Checklistenfetischisten; das kann durchaus anstrengend sein. Regelmäßig aber schärft sich ihr Blick für stimmige und widerspruchsfreie Argumentationen und Begründungen, vielleicht auch für Vollständigkeit der Argumente und Ehrlichkeit im Umgang mit Gegenargumenten. Was Juristen recht gut – wenn auch vermutlich nicht fehlerfrei – können, ist, das Wichtige vom Unwichtigen und das Relevante vom Irrelevanten zu trennen.
Es gibt auch ein paar anstrengende Züge, die Juristen nicht ganz zufällig nachgesagt werden. Ein gewisser Hang zur Besserwisserei ist dabei. Vielleicht noch schwerer wieder abzulegen ist die Neigung, Konflikte ausschließlich nach rechtlichen Maßstäben zu beurteilen, nicht mehr so sehr nach wirtschaftlichen oder gar emotionalen.
Die Liste ist sicher noch ein wenig länger. Für die Zwecke dieses kleinen Texts ist hier erstmal Schluss.
Aber es gibt natürlich Ratgeberliteratur. Das Vorstehende knüpft lose an die Überlegungen an, die ich skizziert habe für Griebel/Schimmel (Hrsg.), Warum man lieber nicht Jura studieren sollte - und trotzdem: Eine Ermutigung, 2. Auflage, Paderborn 2023, S. 83 ff.
Der Autor
Prof. Dr. Roland Schimmel
ist Professor für Wirtschaftsprivatrecht und Bürgerliches Recht an der Frankfurt University of Applied Sciences.
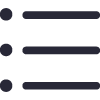
 BÜCHER VERSANDKOSTENFREI INNERHALB DEUTSCHLANDS
BÜCHER VERSANDKOSTENFREI INNERHALB DEUTSCHLANDS